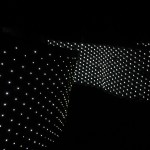suchen
archiv
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- September 2019
- Juni 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- April 2018
- März 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- September 2017
- Oktober 2016
- April 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- August 2015
- April 2015
- Februar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- März 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- Juli 2013
- Mai 2013
- März 2013
- Januar 2013
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Mai 2012
- März 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- Oktober 2010
- September 2010
Archiv des Autors: admin
nimm platz, genosse
In Peking sitzt man gerne. An Straßenecken, in Hauseingängen, auf dem Bürgersteig und auch sonst überall, wo sich die Gelegenheit bietet. Die Sitzgelegenheiten sind genauso unterschiedlich, wie die Orte. Manchmal notdürftig geflickt, manchmal improvisiert, manchmal ausrangiert. Hauptsache, man sitzt gut.
kunsthybride
Im National Art Museum of China ist noch bis zum 17. August die Ausstellung „translife 2011“ zu sehen. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Und das nicht nur, weil der Eintritt kostenlos ist. Die Exponate bewegen sich alle an der Grenze zwischen Kunst, Media Art und Wissenschaft und laden oft zum Mitmachen, Berühren und Ausprobieren ein. Die meisten Werke funktionieren sogar nur, wenn der Betrachter Teil der Installation wird.
Los geht es schon im Hof des Museums – mit dem „Weather Tunnel“. Die Ausstellungsstücke ziehen aus dem Internet Wetter- und Umweltdaten bestimmter Gebiete und setzen sie dann in Sound-
effekte, Bewegungen oder Visualisierungen um. Wie „Weather Inflections“, ein Gemeinschafts-
projekt mehrerer australischer Künstler und Wissenschaftler der Curtin University in Perth und der University of New South Wales in Sydney. In einem alten Reisekoffer landen Echtzeit-Klimadaten aus Perth, die dann in Töne gewandelt werden. Man kann auf die in den Koffer eingelassenen Knöpfe drücken und aus dem aktuellen Klima in Perth Musikcollagen basteln.
Das „Electromechanical Solenoid Orchestra and Weather Ensemble“ von Benjamin Bacon und Joe Saavedra durchzieht fast die Hälfte des Tunnels. Die US-Amerikaner setzen Wetterdaten mithilfe selbstgebauter „Instrumente“ in generative Musik um, deren Rhythmus, Harmonien und Tempo durch die Daten bestimmt werden.
Der erste Ausstellungsteil im Museum trägt den Titel „Sensorium of the Extraordinary“. Und es gibt wahrlich ungewöhnliches zu entdecken. Den Anfang macht „15 Minutes of Biometric Fame“ von Marnix de Nijs aus den Niederlanden. Ein ferngesteuerter Kameradolly sucht per Bewegungssensor nach Besuchern, deren Gesichter er aufnimmt und online mit berühmten Persönlichkeiten abgleicht. Das Resultat wird an die Wand projiziert. So bekommt jeder seine warholschen 15 Minuten Ruhm.
Ein absolutes Highlight ist „Nemo Observatorium“. Hier sitzt man im Auge eines Schneesturms. Um einen herum wirbeln kleine Styroporkügelchen und doch bewegt sich kein einziges Haar auf dem Kopf. Diese Installation von Lawrence Malstaf ist der absolute Publikumsmagnet. Geduldig warten die Besucher in einer Reihe, bis auch sie auf dem Sessel im Zentrum der Apparatur Platz nehmen können. Und das ist in China beim Anstehen sonst eher selten.
Die Japaner Seiko Mikami und Sota Ichikawa locken einen bei „Gravicell: Gravity and Resistance“ auf eine Fläche die mit 255 drucksensitiven Platten ausgelegt und auf allen vier Seiten von einer Leinwand begrenzt ist. Dort kann man durch Hüpfen, Laufen oder Interaktion mit anderen sein eigenes kleines Erdbeben auslösen, dessen Verbreitungswellen auf den Boden und die Leinwände projiziert und in Tonsignale umgewandelt werden. Großartig!!!
Auch bei „E-Static Shadows“ von Zane Berzina und Jackson Tan ist der Mensch Teil der Installation. Man läuft zunächst durch einen dunklen Gang, der mit schwarzem Kunstsamt ausgekleidet ist und in dem breite Streifen aus dünnen Plastiktüten hängen. So lädt man sich statisch auf und kann dann an einem mit LEDs versehenen geschwungenen Band seinen eigenen Schatten sehen. Durch die elektrostatische Ladung gehen die Lämpchen aus.
Der Ausstellungsteil umfasst noch viele andere Stücke, wie den „Artificial Moon“, der aus Hunderten von Energiespar-Lampen zusammengesetzt ist. „Broken Mirror“, einen Spiegel, den der Besucher „zerstören“ kann. „Evolving Spark Network“, eine elektronische Installation, bei der durch Bewegungen an der Decke kleine elektrische Blitze erzeugt werden. Das zauberhafte „Lights Contacts“ bei dem zwei oder mehr Menschen sich berühren und durch den Kontakt mit der Installation Licht und Tonfolgen erzeugen. Alleine bleibt alles schwarz und leise. Oder das sehr merkwürdige „Scales“ bei dem Fische in Aquarien zum Singen gebracht werden. Und das ist genauso frankensteinmäßig gruselig, wie es sich anhört.
Im Teil „Sublime of the Liminal“ verschiebt sich der Schwerpunkt der Ausstellung noch mehr in Richtung Wissenschaft, in Richtung künstliches Leben, intelligente Objekte und hybride Pflanzenwesen.Das Objekt „Breathing“ des Brasilianers Guto Abrega besteht aus einer im Raum schwebenden Pflanze, an deren Blättern man Elektroden angebracht hat. Diese sind mit den freiliegenden Wurzeln verbunden, die an Metallstäbe gebunden sind. Atmet man die Pflanze an, bewirkt die CO2 Veränderung in der Luft eine Bewegung an den Metallstäben und löst Lichtsignale aus, sie reagiert mithilfe der mechanischen Teile auf den Besucher.
Auch „Anatomy of Landscape I-11“ hat die Natur als Thema. Betritt man den Raum, meint man zuerst, plötzlich in der alten Pinakothek gelandet zu sein. Man blickt auf ein Bild, das an die Landschaftsmalerei niederländischer Meister erinnert. Erst beim Näherkommen fällt auf, dass diese Illusion aus Erde und echten Pflanzen nachgebaut wurde, die durch ein ausgeklügeltes System bewässert werden. Die Beleuchtung entspricht dem aktuellen Stand der Sonne.
„The Fish-Bird Seies“ von Mari Velonaki besteht aus drei Teilen. Im ersten agieren zwei Rollstühle, Fish und Bird, miteinander und mit dem Zuschauer. Dabei drucken sie Liebesbriefe aneinander aus. Im zweiten Teil werden die Texte der Liebesbriefe in zwei Würfel projiziert, die man in die Hand nehmen kann. Bewegt man sie vorsichtig, ertönen zu den Zeilen aus den Briefen Klänge. Schüttelt man sie, verstummt die Musik und die Texte werden unlesbar – die Kommunikation bricht ab. Beim dritten Teil kann man handgeschriebene Mitteilungen in einen grauen Sack geben, an dem sich ein rotierender Briefschlitz befindet. Diese werden später zu den Liebesbriefen von Fish und Bird.
Lernende, mit dem Zuschauer interagierende Objekte sind auch die „Performative Ecologies“ von Ruairi Glynn. Diese Roboterwesen befinden sich in einem dunklen Raum und können anfangs gar nichts. Mit der Zeit und durch Interaktion mit dem Betrachter lernen sie, wie sie durch Bewegungen und Licht dessen Aufmerksamkeit fesseln. Außerdem lernen sie voneinander und stimmen sich miteinander ab.
In diesem Ausstellungskapitel gibt es noch viele weitere Stücke. Wie „Bitflow“, bei dem kleine Einheiten durch dünne durchsichtige Schläuche fließen und manchmal Buchstaben bilden, die aber nur aus bestimmten Perspektiven erkennbar sind. Oder „Silent Barrage“, einen Stelenwald, bei dem die Bewegungen der Besucher an den Säulen markiert werden.
„Zone of the Impending“ ist der letzte Ausstellungsteil. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Umwelt und dem Ökosystem. Sehr viele Werke erinnern fast mehr an wissenschaftliche Versuchsaufbauten, und ich hatte Schwierigkeiten, sie nachzuvollziehen.
Die Kanadierin Diane Landry schafft es mit „Knight of Infinite Resignation“ jedoch, die Sorge um die zunehmende Wasserknappheit fast spielerisch darzustellen. Jeweils 12 Plastikflaschen bilden eine Windmühle. Doch statt Wasser enthalten sie Sand, der bei jeder Umdrehung leise rieselnde Geräusche macht und das Verrinnen der Zeit spürbar werden lässt.
„Banana Poetry“ von Ines Krasić nutzt als Energiequelle Zitronen. Sobald genug Elektrizität generiert wurde, setzt eine Maschine diese in neue Zeilen eines endlosen Textes um. Den Inhalt kann man mit bestimmten Parametern wie Erotic HORNY WORDS, Karl Marx KAPITAL WORDS, Shoo bee doo bee do REFREN, Citations WISE WORDS, Poetry POETIC WORDS, Cookbook TASTY WORDS, Self-help HELPING WORDS oder Art manifesto DADA MANIFESTO steuern. Eine ähnliche Maschine, die mit normalem Strom angetrieben wird, druckt Texte aus, die man nach den eben genannten Kriterien zusammengestellt hat. Ein sehr kurzweiliges Spiel, das viele überraschende Ergebnisse ausspuckt. Allerdings ohne Bananen.
„Nuage Vert“ und „Champs d´Ozone, Beijing“ sind Videoinstallationen von Helen Evans und Heiko Hansen, die Umweltverschmutzung durch eine große französische Müllverbrennungsanlage und die Pekinger Luftqualität zum Thema haben. Bei „Nuage Vert“ wird die Verschmutzung als grüne Wolke dargestellt, die aus dem Schornstein der Müllverbrennungsanlage steigt. „Champs d´Ozone, Beijing“ misst in Echtzeit die Schadstoffkonzentration in der Luft und zeigt sie dann anhand eines farblich changierenden Nebels an.
Der Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Kunst, in dem sich „translife 2011“ bewegt, macht die Ausstellung zu einer der spannendsten und innovativsten, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Interessant ist, dass sich diese Überschneidung auch in den Biografien der ausstellenden Künstler wieder findet. Viele haben sowohl einen naturwissenschaftlichen, als auch einen künstlerischen Hintergrund. Viele Projekte waren auch von vornherein interdisziplinär angelegt.
Wer sich näher über die Ausstellung informieren möchte, sollte auf der Website http://www.mediartchina.org/ vorbeischauen. Oder natürlich bis zum 17. August im National Art Museum of China in Peking.
Veröffentlicht unter china
Kommentare deaktiviert für kunsthybride
alles neu
So, nachdem ich die letzten Monate richtig faul gewesen bin… Seit Anfang Mai habe ich eine neue Wohnung. Und das war eine der besten Entscheidungen überhaupt. Statt im tiefen Westen der Stadt, fast eine Stunde vom Zentrum entfernt, wohne ich jetzt direkt nördlich der Innenstadt. Mit der wunderschönen Gulou-Gegend in Laufweite. Und einem der großen Busbahnhöfe um die Ecke.
Allerdings bin ich, soweit ich weiß, die einzige Ausländerin, die sich hier niedergelassen hat. Seit ich hier wohne, habe ich nur zwei Mal andere laowai, wie die Nicht-Chinesen hier genannt werden, zu Gesicht bekommen. Neulich habe ich Obst gekauft. Als der Verkäufer mir eine große Ananas geben wollte, habe ich ihm gesagt, dass ich lieber eine kleine hätte. Daraufhin meinte der Mann neben mir: „Jaja, die braucht keine große Ananas. Die wohnt doch alleine, da ist eine große zu viel. Das verdirbt ja sonst.“ Und ich hatte ihn noch nie vorher gesehen. War etwas seltsam. Die Leute im Viertel sind, nachdem sie sich an mich gewöhnt haben, größtenteils nett. Manchmal fühle ich mich aber doch wie eine Außerirdische. Aber so merkt man mal, wie es ist, wenn man anders als alle anderen aussieht.
Jetzt brauche ich zwar eine Stunde bis ich auf der Arbeit bin, aber der Weg zu U-Bahn entschädigt mich jeden Morgen. Er ist zum einen ganz schön, da er direkt am Kanal entlangführt. Und zum anderen sehr unterhaltsam.
Mir kommen Massen an Leuten entgegen, die in den umliegenden Bürogebäuden arbeiten. Dadurch sehe ich immer, welche Klamotten und Schuhe gerade angesagt sind. Zur Zeit sind es bei den Frauen gestreifte T-Shirt-Kleider oder Kleidchen, die aussehen, wie aus der Biedermeierzeit. Mit Krägelchen und Handschuhen. Teilweise sind die Frauen auch total vermummt, um nicht braun zu werden. Weiße Haut gilt vielen noch als elegant.
Auf dem Weg sehe ich immer einen älteren Mann, der in einem Torbogen seine morgendlichen Tai-Qi Übungen macht. Mit musikalischer Untermalung. Ein Stück weiter die Straße runter steht ein Taxi am anderen. Aber nicht weil die Fahrer auf Kundschaft warten. Hier wird Päuschen gemacht. Die Fahrer holen sich entweder Wasser aus dem Kanal und waschen liebevoll ihre Wagen. Man meint fast, ins sonntägliche Deutschland der 70er Jahre zurückkatapultiert worden zu sein. Oder sie setzen sich miteinander hin und spielen Karten oder Mahjongg, während gleichzeitig viel geraucht und erzählt wird. Da es hier mittlerweile richtig heiß ist rollen sie ihre Hemden über den Bauch hoch oder ziehen sie gleich ganz aus. Wie fast alle Männer in der Stadt. Die Nackte-Wampen-Dichte steigt proportional zur Temperatur.
Einige Pekinger kommen schon früh an den Kanal, packen ihre Angelruten aus und fischen. Das kann den ganzen Tag dauern. Ab und zu kommen Freunde zum Plaudern vorbei oder Leute, die was zum Essen bringen. Andere setzen sich auf die Bänke und lesen oder üben sich in der Pekingoper. In der Unterführung nahe meiner Wohnung sitzt Nachmittags ein älterer Herr, der Lieder auf einer Art Trompete spielt. Weil die Akustik dort so gut ist. Ich freue mich immer, wenn ich ihn im Vorbeigehen höre.
Veröffentlicht unter china
Ein Kommentar